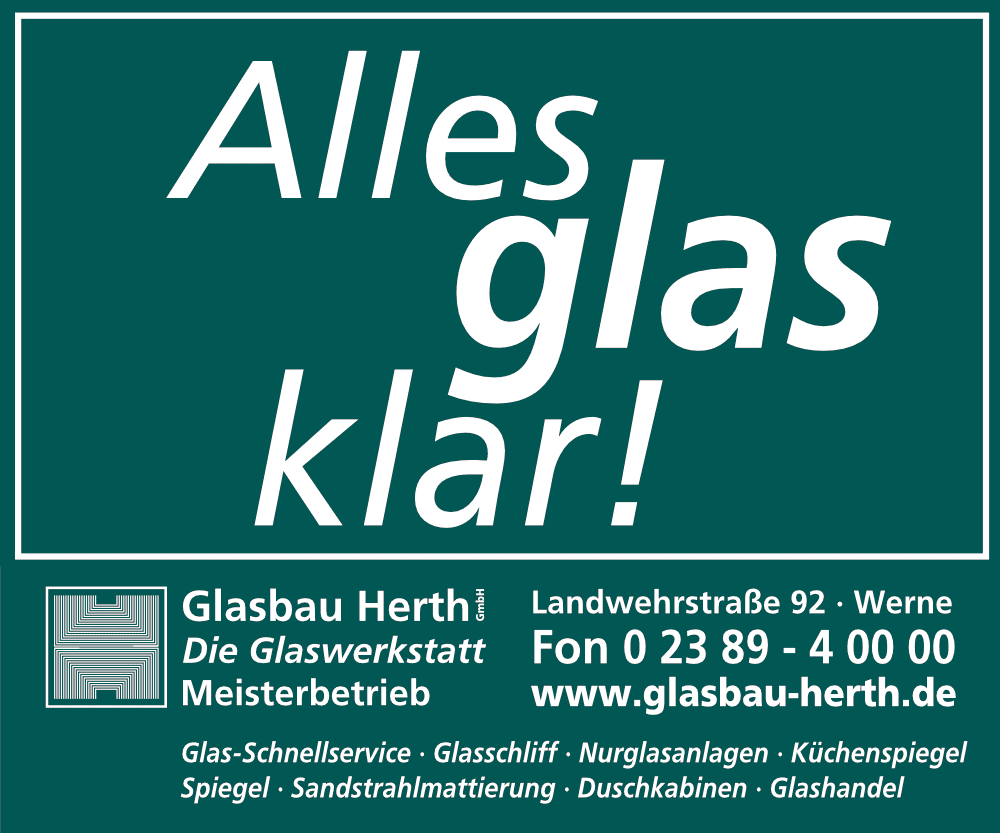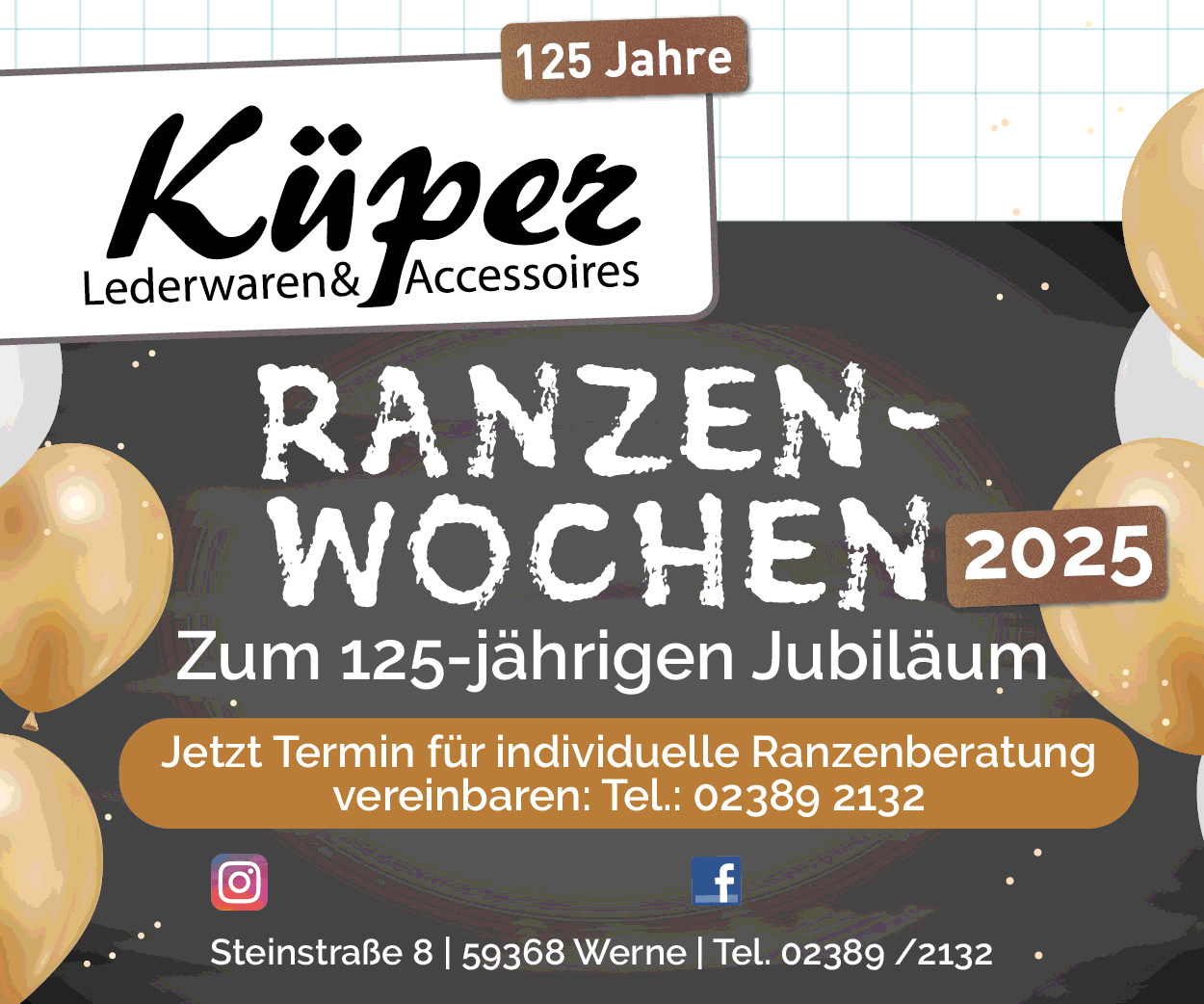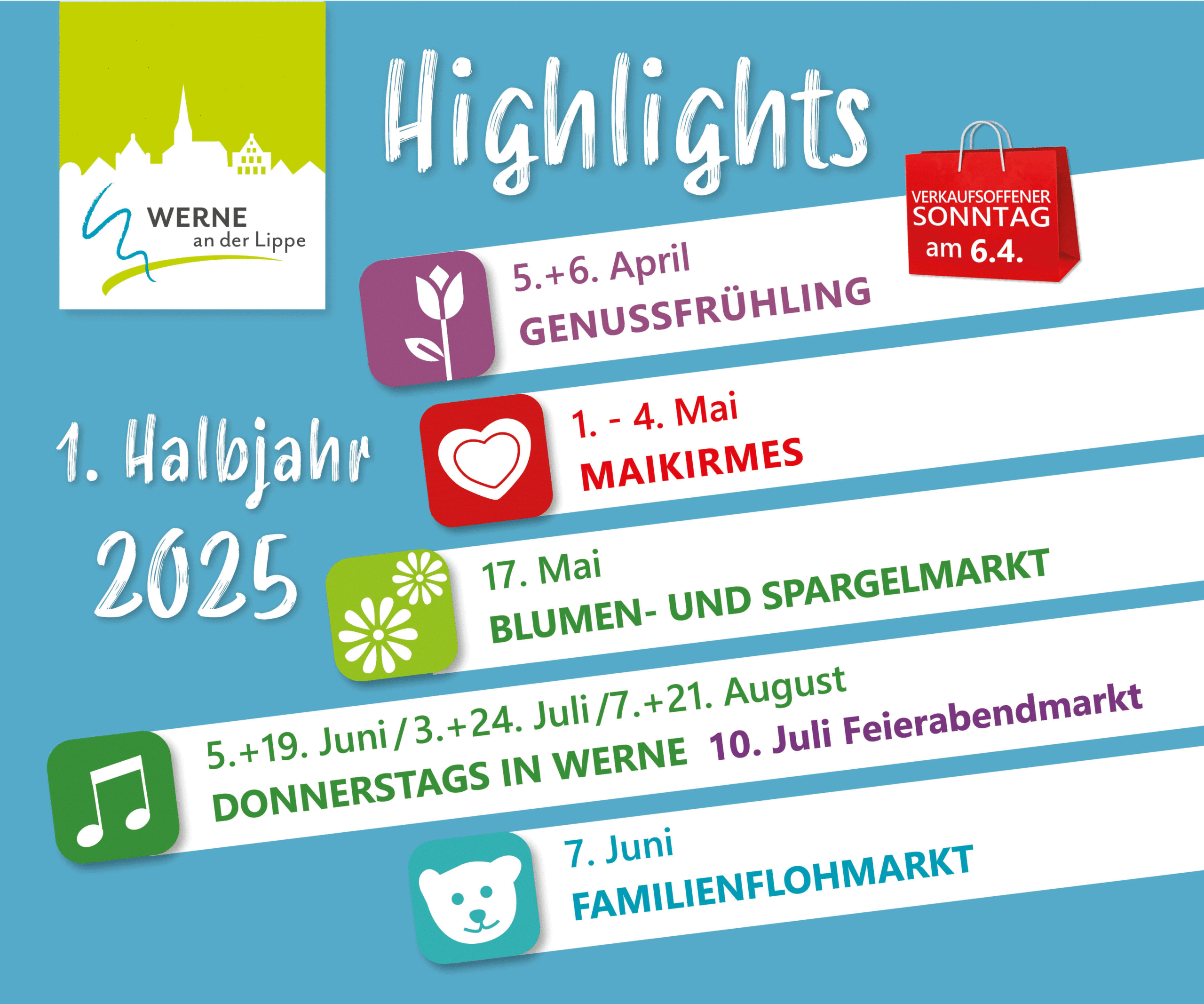Minimalistischen Menschen mag zu Weihnachten eine Krippe mit Jesus, Maria und Josef genügen. Andere lieben es üppiger. In Kirchen haben sich seit Jahrhunderten die vielfigurigen Krippen eingebürgert. Eine besonders umfangreiche Staffage stammt aus St. Konrad und wird zu Weihnachten in der neuen Kapelle auf dem Kirchberg aufgestellt. Und zwar frisch restauriert.
18 Gipsfiguren sind es, die sich derzeit noch in der Werkstatt von Anne-Sophie Hinnüber–Eysing und Patricia Schering befinden: von der Kerngruppe Maria, Kind und Josef über Hirten und Schafe bis hin zu Weisen aus dem Morgenland samt Kamelen und Kameltreibern. Die beiden Restauratorinnen aus Coesfeld haben die etwa 30 bis 50 Zentimeter hohen Skulpturen fachmännisch gereinigt und ausgebessert. Und sind sehr angetan von der Vollständigkeit der Krippe. Denn vom Jesuskind einmal abgesehen, haben sich alle Figuren der ursprünglichen Ausstattung erhalten. Gefertigt wurde die Krippe um 1900, eine Marke an den Figurenrückseite weist eine Manufaktur aus Kevelaer als Hersteller aus.
„Wir haben hier eine einheitliche Staffage, kein Sammelsurium von vielen Schafen und unvollständigen Weisen“, sagt Hinnüber-Eysing. Ihre Kollegin ergänzt: „Sie tragen sogar noch die originale Fassung.“ Die hat allerdings im Laufe der Zeit sichtbar gelitten. „Die Figuren haben halt das typische Krippenschicksal durchgemacht: Sie wurden rausgeholt, aufgestellt, weggepackt – und das immer wieder“, erklärt Schering. Dabei platzte die Farbe auf dem Gips ab; hier und da brachen Arme oder Finger ab. Zum Glück für die Restauratorinnen: Fast alle Bruchstücke wurden aufbewahrt – wohl um sie beizeiten anzukleben. In einigen Fällen war das bereits geschehen, als Schering und Hinnüber-Eysing die Krippe in Obhut nahmen. „Leider unsachgemäß, aber dafür haben sich die Fragmente erhalten“, sagt Hinnüber-Eysing.
Wo ein Fingerchen oder Schäfchenohr unwiederbringlich verloren gegangen sind, gipsten die Restauratorinnen die fraglichen Teile nach. Anschließend kitteten sie originale und neue Bruchstücke sachkundig auf und passten sie farblich an. Dafür verwendeten sie reversible Farben wie Gouache oder Aquarellfarben. Diese sind wasserlöslich und daher wieder abnehmbar. Grundsätzlich achten die Expertinnen darauf, dass neue von alten Teilen zu unterscheiden sind. Und sie greifen so wenig wie möglich in den ursprünglichen Zustand ein. „Die alte Optik soll tunlichst erhalten bleiben“, lautet ihr Credo.

Wie die mehr als 100 Jahre alte Krippe in den 1950er- oder 1960er-Jahren nach St. Konrad gekommen ist, vermag der Hausherr, Pfarrdechant Jürgen Schäfer, nicht mehr nachzuvollziehen. Jetzt strahlen die zuvor stark verrußten Krippenfiguren in neuem Glanz. Der lenkt den Blick auf liebevolle Details: ein Weihrauchfass, dass in der Hand eines Königs baumelt sowie ein Hirtenstab, der extra aus Metall geformt wurde. Schering weist auf ein weiteres putziges Element hin: Manche Schafe haben zur Unterstützung ihrer dünn geformten Beinchen eine kleine Standhilfe – eine Art Palme, die unter ihren Bauch montiert wurde.
Ursprung der Weihnachtskrippe
Um den Ursprung der Weihnachtskrippe ranken sich viele Geschichten. So soll der Brauch auf den heiligen Franz von Assisi zurückgehen: Anstelle einer Predigt stellte er 1223 die Weihnachtsgeschichte mit lebenden Tieren und Menschen nach. Frühchristliche Darstellungen reduzieren das Geschehen auf das Jesuskind in der Krippe, flankiert von Ochs und Esel. Weder der eine noch der andere werden in den Evangelien erwähnt. Lukas, der die Geburt Christi in Bethlehem ausführlicher beschreibt, erwähnt lediglich dass Maria ihr Neugeborenes in Windeln wickelte und in eine Krippe legte. Ochs und Esel wurden später hineininterpretiert, wohl auf Grundlage einer mahnenden Bibelstelle im Buch Jesaja. Auch Weihnachtsdarstellungen auf spätgotischen Gemälden oder Schnitzaltären kommen als Vorbild für die Krippen infrage. Erst in dieser Zeit setzte sich die dreifigurige Kernfamilie als Mittelpunkt durch. Davor hatten die Künstler Josef als Nährvater Jesu lange vernachlässigt. Er tauchte entweder gar nicht auf oder führte ein Schattendasein am Rande. Immerhin wird er dort oft als erster Hausmann der Geschichte tätig – wäscht Windeln oder kocht Brei fürs Baby.